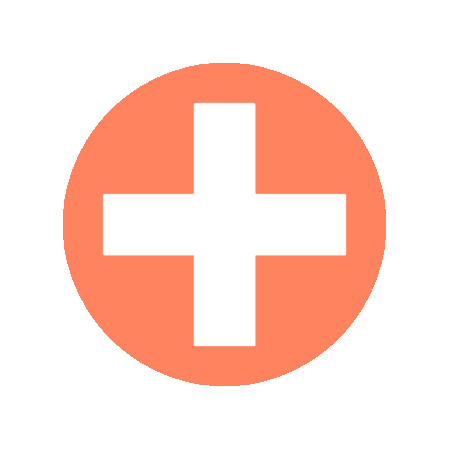Einsatzkräfte stürmten Ende Juli die NS-Gedenkstätte Peršmanhof in Südkärnten und das dort stattfindende Antifa-Camp. Sie begründeten den Polizeieinsatz mit wildem Campen und Verstössen gegen das Naturschutzgesetz.
Am Sonntag, dem 27.Juli, haben ein gutes Dutzend teils schwer bewaffnete Polizist·innen unter der Führung eines Beamten des Staatsschutzes, begleitet vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, sowie der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, einem Polizeihelikopter, Drohnen und einer Hundestaffel das antifaschistische Bildungs-Camp am Peršmanmuseum überfallsartig durchsucht und die Identität der Teilnehmenden registriert. Der Einsatz dauerte 4 Stunden; 3 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Camp-Mitorganisatorin Mira Gabriel erinnert sich an den Sonntag, als die Polizei das Museum stürmte: «Ein Polizist stand vor uns, hat geschrien, eine Hand an der Waffe und mit der anderen gezittert, weil er nervös war. Das ist wirklich keine gute Kombination.»
Rund 60 Personen nahmen am Camp teil. Organisiert hatte es der Klub slowenischer Studierender in Wien (KSŠŠD) – mit ausdrücklicher Zustimmung der Museumsleitung, die das Zelten auf dem Gelände erlaubte.
Neben Studierenden und Aktivist·innen waren auch Nachkommen von Opfern anwesend, von denen mehrere angaben, durch die Ereignisse retraumatisiert worden zu sein. Einer von ihnen ist Bernard Sadovnik, Bürgermeister des Nachbarorts Globasnitz und Vorsitzender des Volksgruppenbeirats: «So ein massiver Polizeieinsatz genau 80 Jahre nach dem Massaker reisst bei mir als Nachkomme Wunden auf. Ich bin ohne Worte und von den Gesprächen mit den jungen Menschen vor Ort zutiefst betroffen. Ich fordere eine sofortige lückenlose politische Aufarbeitung dieses skandalösen Vorfalls.”
Die Museumsleitung am gleichen Tag in einer Presseaussendung: «An einem Ort, an dem kurz vor Ende des 2. Weltkrieges Angehörige des SS- und Polizeiregiments 13 in einem Überfall elf Angehörige der Familien Sadovnik und Kogoj brutal ermordeten, darunter 7 Kinder, muss ein derart unverhältnismässiges und aggressives Vorgehen als pietät- und respektlos aufgefasst werden. Die Bildungs- und Gedenkarbeit für anwesende Besucher·innen wurde dadurch gravierend gestört.» Markus Gönitzer, Obmann Društvo/Verein Peršman: «Ein solches Vorgehen der Behörden und der Exekutive zeugt von grosser Ignoranz und fehlender Sensibilität gegenüber dem sensiblen historischen Kontext, in dem das Museum Peršmanhof arbeitet. Im Erinnerungsjahr 2025 ist ein solches Vorgehen an einem ehemaligen NS-Tatort nicht nur eine schmerzliche Erfahrung für das Museum Peršman, sondern für alle Gedenkstätten und -initiativen unseres Landes. Was sagen diese Ereignisse über die Wertschätzung gegenüber der Kärntner slowenischen Volksgruppe und ihrer Geschichte aus?»
Das einzige Museum dieser Art
Der ehemalige Bergbauernhof Peršman in der Gemeinde Bad Eisenkappel liegt in 1.000m Seehöhe, 12 km vom Ort entfernt, umgeben von Viehweiden und Wäldern. In der Nazizeit unterstützten die slowenischsprachigen Bewohner·innen des Hofes den antifaschistischen Befreiungskampf mit Lebensmitteln, Kleidung und Unterkunft, bis Ende April 1945 die SS das Massaker verübte und den Hof niederbrannte. Die Mörder wurden nie bestraft, die slowenische Sprachgruppe in Kärnten nach 1945 weiterhin diskriminiert und der antifaschistische Widerstand geächtet, obwohl Österreich 1955 nicht zuletzt aufgrund des eigenen Beitrags zur Befreiung vom Faschismus seine Souveränität mit dem Staatsvertrag (der Verfassung) wiedererlangte. Die alliierten Truppen zogen ab.
Jahrzehntelang blieben vom Peršman nur Ruinen zurück bis Anfang der 1980er Jahre Freiwillige aus Jugoslawien und Österreich das Wohnhaus wieder aufbauten, eine Gedenkstätte und ein Museum einrichteten, das einzige Museum dieser Art in Kärnten.
Der Sitz des Europäischen Bürger:innen Forums Österreich befindet sich nur wenige Kilometer vom Peršman entfernt, auf dem Stopar, dem Bergbauernhof der Europäischen Kooperative Longo maï. Am Tag der Razzia besuchten mehrere Teilnehmer·innen des Antifa-Camps einen Kräuterkurs am Stopar. Seit der Eröffnung des Museums 1982 haben wir allen unseren Gästen das Peršmanmuseum gezeigt. Sofort nach dem Polizeieinsatz informierten wir Freund·innen im In- und Ausland. Zahlreiche Protestbriefe sind danach im Innenministerium, beim Bundeskanzler und beim Landeshauptmann (Chef der Landesregierung) eingegangen. Siehe Kasten unten. Viele Organisationen und Einzelpersonen kritisierten den Polizeieinsatz, u.a. die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, das DÖW (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes), die österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück, die katholische Kirche Kärntens und alle Parteispitzen, ausser die FPÖ. In Wien und Klagenfurt fanden wenige Tage nach dem Übergriff gut besuchte Protest-Kundgebungen statt.
«Ein Einsatz wie jeder andere»
Und die Polizei? Der Einsatzleiter im Krankenstand, Schweigen, niemand übernimmt die Verantwortung. Zwei Tage nach dem Übergriff erklärt Kärntens stellvertretender Polizeidirektor Plazer in der ZIB II, den Spätnachrichten des ORF, es handle sich um einen Einsatz wie jeder andere. Er habe gegenüber Volksgruppenvertreter Sadovnik sein Bedauern ausgedrückt. Eine Entschuldigung gegenüber der Museumsleitung und den Campteilnehmer·innen lehnte er ab. Auf die Frage des Moderators, warum bei Verstössen gegen das Naturschutzgesetz der Verfassungsschutz anrücke, antwortete Plazer, die Antifa, das seien ja die Linken und es sei doch bekannt, dass da immer Extremisten dabei seien. Antifaschismus steht anscheinend bei der Kärntner Polizei generell unter Extremismusverdacht. Auch das verbriefte Recht der Kärntner Slowen·innen, bei der Befragung in ihrer Muttersprache zu sprechen, wurde von manchen Exekutivbeamten als Provokation, Eskalation oder gar Widerstand gegen die Staatsgewalt gewertet.
Mitorganisatorin Mira Gabriel findet es unverschämt, dass der Einsatzleiter die Razzia damit rechtfertigte, das Bildungscamp stelle einen «sittenwidrigen Umgang» mit der Gedenkstätte dar: «Als Nachfahren gedenken wir des Widerstands. Und zwar nicht nur, indem wir kurz hinfahren, weinen und wieder gehen. Dass uns Polizisten vorschreiben wollen, wie wir zu gedenken haben, ist eine Frechheit.»
Mehrere Teilnehmer·innen sprechen von Einschüchterung und vermuten eine politische Motivation hinter dem Einsatz. So auch der Rechtsanwalt der Kärntner Slowen·innen, Rudi Vouk, der gegenüber dem ORF sagt: «Meiner Meinung nach war das eine von langer Hand geplante Aktion, mit dem Ziel, Jugendliche, die das antifaschistische Gedenken kultivieren, einzuschüchtern.» Vouk vermutet, es sei vor allem darum gegangen, an die Personalien der Teilnehmenden zu kommen, und hat Anzeigen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch eingebracht.
Geht es gegen rechts, agieren die Sicherheitsbehörden deutlich milder. An dem Wochenende, an dem die Razzia in Kärnten stattfand, veranstaltete die rechtsextreme Identitäre Bewegung eine Demo in Wien. Trotz verhetzender Parolen wie «Ausländer raus! Deutschland den Deutschen!» zeigte die Polizei ausschliesslich Personen der Gegendemos an.
Slowenischer Botschafter fassungslos
Politischer Druck kommt aus dem Nachbarland Slowenien. Die slowenische Aussenministerin Tanja Fajon fordert Aufklärung. Der scheidende Botschafter Sloweniens in Wien, Aleksander Geržina bezeichnet den Polizeieinsatz als «Stunde null für Kärnten». Er könne immer noch nicht fassen, «dass so etwas in einer demokratischen Republik möglich ist. Hier wurde jedes Augenmass verloren», sagte der Diplomat. Er wies darauf hin, dass im Vorjahr dieselbe Veranstaltung an dem Ort stattgefunden habe. «Damals ist nur ein Polizist gekommen, und nach fünf Minuten war er wieder weg», sagte er. Besonders schockiere ihn die brutale Festnahme von Nikolaj Orasche, dem Sekretär des Verbands der Kärntner Partisan·innen. Orasche wurde von einem Polizisten zu Boden gedrückt und verhaftet, als er darauf bestand, in seiner slowenischen Muttersprache zu sprechen. Es existiert eine Videoaufnahme. Vom Innenministerium und vom Landeshauptmann forderte der Botschafter rasche Aufklärung. «Es kann ja nicht Wochen dauern, dass man herausfindet, wer was wem angeordnet hat. Dabei war gerade der Kampf der Kärntner Partisan·innen ganz wichtig für die Wiederherstellung Österreichs.»
Auf den Druck reagierten Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), die beide betonten, dass Einsätze an so einem Ort Sensibilität erfordern – eine recht diplomatisch formulierte Kritik an dem Polizeieinsatz. Die Grünen richteten gleich am nächsten Tag eine parlamentarische Anfrage mit 55 Fragen an den Innenminister. Sie wollen unter anderem wissen, wer den Einsatz angeordnet hat und ob das Ministerium davon wusste.
Kommission eingesetzt
Innenminister Karner (ÖVP) und Landeshauptmann Kaiser (SPÖ) sind um Schadensbegrenzung bemüht und haben eine Untersuchungskommission eingerichtet. Peršmanhof-Vizeobfrau Eva Hartmann dazu: «Auch wenn jetzt verschiedene Spekulationen und, ja sozusagen Nebelgranaten geworfen werden, ist der Ursprung zwei Wochen nach dem Einsatz nicht geklärt. Und das ist aus unserer Sicht das gravierende Problem in dieser Diskussion.» Die Vereinsleitung begrüsse die Einsetzung der Kommission.
Die multiprofessionelle Kommission besteht aus Vertreter·innen der beiden Peršman-Vereine, der kärntner-slowenischen Volksgruppe, der Direktorin der KZ-Gedenstätte Mauthausen, Beamt·innen des Innenministeriums und Personen aus den Bereichen Wissenschaft und Recht. Laut Innenministerium werde die Kommission ihre Arbeit sofort aufnehmen und bis Ende September Ergebnisse liefern.
Für Vereinsobmann Gönitzer hat «Österreich anscheinend noch immer ein Problem damit, sich zu Antifaschismus zu bekennen, wo er nicht nur symbolisch vor sich hergetragen wird. Dass jetzt herumdiskutiert wird, ob es eine Provokation war, dass Slowenisch als Amtssprache eingefordert wurde, zeigt ja, dass das Bekenntnis zum Artikel 7 des Staatsvertrags (in der die Rechte der Minderheiten festgelegt sind) noch immer nicht existiert, genauso wenig wie das Bekenntnis, dass Antifaschismus ein Grundpfeiler dieser Demokratie ist.»
Die gute Nachricht: Das Thema kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor erscheinen Berichte in der Presse und den Sozialen Medien. Wir werden nicht zulassen, dass Antifaschismus kriminalisiert wird!
Heike Schiebeck, EBF-Österreich
Einer der vielen Briefe
Auszüge aus dem Brief einer Freundin, die seit Jahrzehnten das Gästehaus des Hof Stopar besucht:
«Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, mit ungläubigem Erstaunen habe ich die Berichte zum Polizeieinsatz am Peršmanhof zur Kenntnis genommen. Ich kenne die Gedenkstätte, seit ich Ende der 1980er Jahre zum ersten Mal in Eisenkappel war. Seitdem habe ich fast jedes Jahr einen Urlaub dort verbracht, habe die Geschichte der Kärntner Slowen_innen kennengelernt, viel dazu und darüber gelesen und auch an einer Reihe von Gedenk- und Kultur-Veranstaltungen teilgenommen. Ich wollte verstehen, was während der Zeit des Nazi-Faschismus in Kärnten geschehen ist und warum es in der Zeit danach zu ständigen Verletzungen der Minderheitenrechte kam. Ich habe die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Volksgruppen seitdem mitverfolgt, und mich gefreut, dass es auf beiden Seiten Menschen gab, die diese Beziehungen ändern, verbessern wollten. Für mich ist dieser Polizeieinsatz 80 Jahre nach den Morden der SS während eines Camps, bei dem junge Menschen sich damit befassen, der Opfer zu gedenken und zu überlegen, wie man gegen ein erneutes Aufkommen des Faschismus vorgehen kann, nicht nachvollziehbar und völlig unangemessen. (...)
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich dafür einsetzen:
- dass die Befehlskette des Polizeieinsatzes am 27.7. vollständig transparent gemacht wird;
- dass der Einsatz von Hubschrauber, Hundestaffeln, Drohnen bei Ausweiskontrollen und Verwaltungsangelegenheiten auf Amtsmissbrauch geprüft wird;
- dass Sie sicherstellen, dass Bildungs-Camps, Workshops und Erinnerungsarbeit an der Gedenkstätte Peršman in ihrer frei gewählten Form weiterhin stattfinden können.»
Ellen Thielen-Vafaie, Würselen (bei Aachen)