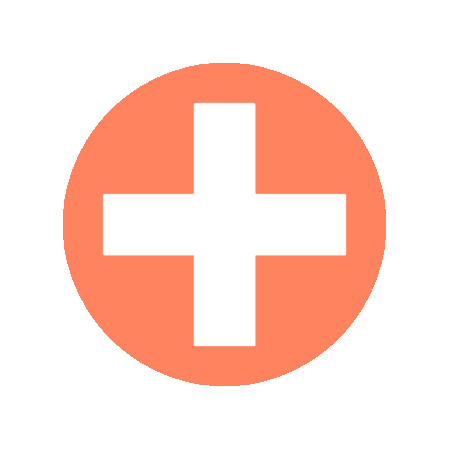Die Frischwarenabteilungen der Supermärkte locken wieder mit roten Erdbeeren oder Paradeisern, grünen Gurken und buntem Paprika - täglich frisch geliefert. Wer von uns fragt sich bei diesem Hochglanz-Konsumangebot noch, welchen Weg diese Lebensmittel hinter sich haben und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden?
Auf mehr als dreißigtausend Hektar erstrecken sich die Plastikgewächshäuser im "Poniente", der Region zwischen El Ejido und Almeria im südspanischen Andalusien. Auf dieser Flä-che wird für jeden und jede EuropäerIn - ob Mann, Frau oder Kind - mehr als zehn Kilo Treibhausgemüse im Jahr produziert. Es handelt sich um die größte Konzentration von Gemüse- und Obstanbau unter Plastik weltweit. Während der Hochsaison im Winter verlassen täglich tausend Lastwagen das "Plastikmeer", um die Ware an die Supermärkte in ganz Europa auszuliefern. Eine zerstörte Umwelt, eine von Pestiziden und üblen Gerüchen gesättigte Luft, eine Landschaft ohne Grünflächen, ohne Bäume, ohne sauberes Wasser, ohne Lebewesen, eine industrielle Einöde, die apokalyptische Züge annimmt. Das ist der Preis.
Auch für die Menschen ist hier kein Platz mehr. Es zählen nur noch die Arbeitskräfte: Sie müssen jederzeit zur Verfügung stehen, wie betriebsbereite Landmaschinen; am besten sie leben in Rufweite in einem Plastikverschlag. Wenn das Gemüse reift, die Preise gut sind und die Großverteiler winken, braucht es schnell viele fleißige Hände - die Hände von ArbeitsmigrantInnen, die man ebenso schnell wieder entlassen kann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Sie kommen aus Marokko, Schwarzafrika, aus Lateinamerika oder neuerdings aus Osteuropa. Sie arbeiten zu niedrigsten Löhnen und unter Bedingungen, die Einheimische nie akzeptieren würden. Eine verschärfte Konkurrenz zwischen den verschiedenen MigrantInnengruppen, soziale Ausgrenzung und Rassismus sind feste Bestandteile dieses Systems.
Aber was in El Ejido passiert, ist nicht ein Krebsgeschwür der modernen Landwirtschaft, sondern die konsequente Umsetzung von agroindustriellen Leitlinien. Andalusien ist vielleicht ein Extremfall, doch das in der EU dominierende Landwirtschaftsmodell des "Wach-sens oder Weichens" bringt in ganz Europa ähnliche Strukturen hervor, ob auf den Pfirsichplantagen Südfrankreichs, in den holländischen High-Tech-Glashäusern, oder auf den Spargel- und Erdbeerfeldern des Marchfelds. Um gewinnbringend zu wirtschaften und konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die modernen Agrarunternehmen über eine Reservearmee von billigen, möglichst rechtlosen, ausländischen MigrantInnen verfügen können. Denn die Arbeitskräfte stellen den einzigen variablen Kostenfaktor im Produktionsprozess dar.
Zur Frage, wie intensive Landwirtschaft, Arbeitsmigration und Fremdenfeindlichkeit zusammenhängen, hat das Europäische BürgerInnenforum soeben eine Broschüre mit dem Titel "Bittere Ernte - Die moderne Sklaverei in der industriellen Landwirtschaft Europas" veröffentlicht.* Sie informiert über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Saisoniers und ErntehelferInnen in Spanien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich, Deutschland und Polen. Weitere Artikel setzen sich mit den Auswirkungen der EU-Agrar- und Migrationspolitik auf die Situation der LandarbeiterInnen auseinander. Außerdem wird die Rolle der Großverteiler untersucht: Zwischen 70 und 80 Prozent des europäischen Lebensmittelmarktes werden heute von wenigen Großhandelsketten beherrscht, die durch ihre Monopolstellung die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse ständig nach unten drücken. Darüber hinaus will die Broschüre zu einer allgemeinen Diskussion anregen und wirft einige grundsätzliche Fragen auf: Wohin führt die wachsende Entfremdung von den Grundlagen unserer Nahrungsmit-telproduktion? Welche Landwirtschaft wollen wir, welche Beziehungen zwischen Mensch und Natur, Gesellschaft und Landwirtschaft?
Kathi Hahn
\ "Bittere Ernte - Die moderne Sklaverei in der industriellen Landwirtschaft Europas":
128 Seiten A5; Preis: 12 € (inklusive Versandkosten: 14 €), Solidaritätspreis: 30 €. *
Bestelladressen:
Schweiz Europäisches BürgerInnenforum / CEDRI
St. Johanns-Vorstadt 13
Postfach
CH-4004 Basel
Tel.: +41(0) 61 262 01 11, Fax: +41(0) 61 262 02 46
e-mail: eurocoop@swissonline.ch
Internet: www.civic-forum.org
BRD Europäisches BürgerInnenforum
Hof Ulenkrug
D-17159 Stubbendorf bei Dargun
Tel.: +49(0) 39959 20 329, Fax: +49(0) 39959 20 399
e-mai: ulenkrug@t-online.de
Österreich
Europäisches BürgerInnenforum
Lobnik 16
A-9135 Eisenkappel/Zelezna Kapla
Tel.: +43(0) 4238 87 05, Fax: +43(0) 4238 87 05-4
e-mail: austria@civic-forum.org
Als Download hier der *Umschlag der Broschüre im PDF-Format* .