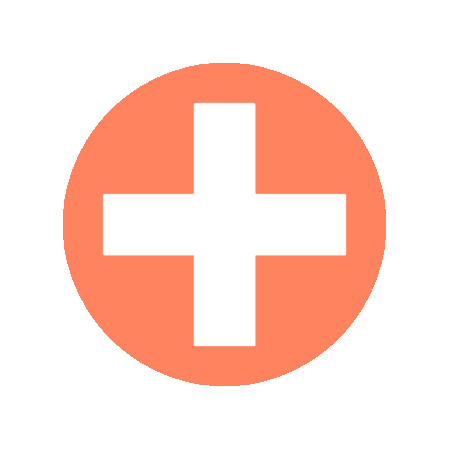Seit einiger Zeit moderiere ich in Zusammenarbeit mit dem Team des französischen Vereins und Mediums Inf’OGM die Radiosendung «Raconte-moi les OGM» (Erzähl mir von den genveränderten Organismen, GVO) auf Radio Zinzine. Die Dinge, die ich dadurch erfahre, erschrecken mich immer wieder aufs Neue: die zutiefst umweltschädlichen Machenschaften der industriellen Förderer dieser Eingriffe ins Leben und der zynische Wille, das Leben zu besitzen und zu manipulieren.
Die letzte Sendung über das Thema: «Die NBIC-Konvergenz» war bis jetzt die Erschreckendste. Ich persönlich kannte noch nicht, was unsere Gesprächspartnerin Hélène Tordjman als «ein Gesellschaftsprojekt» beschreibt, das sich im Verborgenen entwickelt. Hélène ist Dozentin für Wirtschaftswissenschaften an der «Université Sorbonne Paris Nord» und Autorin des Buches «La croissance verte contre la nature – critique de l'écologie marchande», (La Découverte, 2021). Sie ist auch Mitglied des Verwaltungsrates von Inf'OGM. Hier eine Zusammenfassung der Sendung: Die neue Wirtschaft der 1990er Jahre, die auf dem Internet und der Biotechnologie basiert, hat sich trotz der Krise von 2001 weiterentwickelt und die Aussicht auf nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten zwischen Nanotechnologie (N) und Biotechnologie (B), Informationswissenschaft (I) und Kognitionswissenschaft (C) eröffnet, die durch eine gemeinsame Sprache vereint sind, nämlich die der Komplexität. Die Forschung wurde finanziert von den USA, gefolgt von Japan, Europa und den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China), von Stiftungen wie der Rockefeller-Stiftung oder Bill und Melinda Gates sowie von grossen Unternehmen, allen voran Google und seine Muttergesellschaft Alphabet. Um ihre Entstehung nachzuvollziehen und ihre Inspiration zu verstehen, muss man auf eine wegweisende Konferenz zurückblicken. Diese fand im Dezember 2001 in Washington unter der Schirmherrschaft der «National Science Foundation» (NSF) und des Handelsministeriums («Department of Commerce») statt und forderte die Konvergenz dieser verschiedenen Technologien, um die Gesellschaft von morgen aufzubauen: «Konvergierende Technologien zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit» lautete der Titel.[1]
Die Enthusiast·innen, geblendet von der kolossalen Macht, die dem Homo sapiens durch diese technischen Fortschritte in die Hände gelegt wurde, nennen sie die neue Renaissance oder die vierte industrielle Revolution. Oder, wie es die Ökonomin Geneviève Azam ausdrückt: «Der prometheische Wahn einer unendlichen Beherrschung der Welt.» Für Laetitia Pouliguen, Direktorin des Think Tanks «NBIC Ethics», besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft in dystopische und transhumanistische Exzesse abgleitet, wenn die Verbreitung von KI und Algorithmen nicht mit einer Reflexion über die Natur des Menschen einhergeht. Es ist offensichtlich, dass unser Alltag durch den Einfluss von Maschinen, KI und Algorithmen in unserem täglichen Leben grundlegend verändert wird, sei es in unserer Beziehung zur Realität oder zu anderen.»
«Es geht darum, die Kontrolle über die biophysikalischen und biochemischen Prozesse auf der Erde zu übernehmen, alle Lebewesen, das Klima und letztlich die gesamte Biosphäre zu zähmen.»[2]
Laut Hélène Tordjman gibt es bereits Hunderte von Anwendungsbeispielen für diese Verfahren. Welche Verbindung besteht zwischen NBIC und GVO? «Die Leistungsfähigkeit von Computern und künstlicher Intelligenz ermöglicht es heute, die Genome lebender Arten in industriellem Maßstab zu entschlüsseln, was grosse Unternehmen wie BASF dazu veranlasst, Gensequenzen von Tausenden von Arten zu patentieren, um sich das Leben anzueignen. Kürzlich gelang es Wissenschaftler·innen, den ersten vollständig künstlichen lebenden Organismus, den Xenobot, zu erschaffen. Dieser ist in der Lage, sich zu bewegen, zu regenerieren und sich selbst zu reproduzieren.» [2]
Sie erwähnt die «künstliche Hornhaut und Retina, mit welcher Soldaten auch infrarot sehen könnten, sowie die künstliche Vermehrung der roten Blutkörperchen, die es ermöglichen würde, so viel Sauerstoff aufzunehmen, dass ein Mensch vier Stunden unter Wasser bleiben könnte, ohne zu atmen.» Das Unternehmen «Neuralink» von Elon Musk versucht, Gehirnimplantate herzustellen, um die kognitiven Fähigkeiten zu steigern. «In einer von NBIC dominierten Welt gibt es immer weniger Platz für den Menschen und die Menschheit. Es ist eine Art eugenische Welt, in der diejenigen, die sich für Implantate entschieden haben, um ihre kognitiven Fähigkeiten zu steigern, angeblich überdurchschnittlich intelligent sind und Entscheidungen treffen werden, und alle anderen, die sich weigern, sich zu verbessern, sich mit der Technik zu verschmelzen, eine Unterart bilden werden. Sie werden die Schimpansen der Zukunft sein. Das ist ihre Vision der Gesellschaft.»[4]
Welche Rolle spielt Europa?
Laut Laetitia Pouliguen sei Europa, historisch gesehen, der erste Ort philosophischer und moralischer Reflexion und sollte es auch in den Spitzensektoren bleiben: «Wir Europäerinnen und Europäer stehen zwischen zwei Feuern, auf der einen Seite die amerikanischen GAFAM und auf der anderen Seite die chinesischen BATX (Baidu, Alibaba, Tencent und Xiaomi).»3 Leider ist das nur ein Teil der Realität in Europa. Im Englischen würde man das als Wunschdenken bezeichnen. Denn natürlich wollen europäische Unternehmen und Regierungen diesen äusserst lukrativen Zug nicht verpassen. Emmanuel Macron ist stolz darauf, dass der Gipfel für Massnahmen zur künstlichen Intelligenz am 6. und 7. Februar in Paris stattgefunden hat. Bei dieser Veranstaltung kamen Forscher·innen, Unternehmensleiter·innen, politische Entscheidungsträger·innen und Expert·innen zusammen, um Ideen auszutauschen, innovative Forschungsergebnisse vorzustellen und sich mit den Herausforderungen der KI in Bereichen wie Biologie, Physik, Wirtschaft und Ethik auseinanderzusetzen. Auf der Website des Elysée-Palasts wurde darauf hingewiesen, dass dieser Gipfel «Fragen beantworten soll, die sich für alle stellen». Die erste von drei aufgeworfenen Fragen lautet: «Wie können Technologien und Anwendungen der KI in allen Ländern der Welt massiv ausgebaut werden». Bereits am 7. Februar kündigte der französische Präsident ein Bauprogramm für 35 neue «Datenzentren» in Frankreich an. Diese Standorte, die insgesamt etwa 1200 Hektar einnehmen sollen, werden jeweils eine Fläche von 18 bis 150 Hektar haben. Sie sind extrem energieintensiv. Die Stromnachfrage wird bis 2030 voraussichtlich etwa 35 Gigawatt (GW) erreichen, gegenüber 10 GW heute! Bereits am 6. Oktober 2022 wurde der Plan der Regierung zur Energieeffizienz von der damaligen Premierministerin Élisabeth Borne veröffentlicht, die «zur allgemeinen Mobilisierung des Staates, der Gebietskörperschaften, der Unternehmen und der Bürger·innen» aufrief.
In Frankreich existiert die von Hélène Tordjman beschriebene Konvergenz vor allem in Grenoble. «Die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Ökosystems von Grenoble beruhen auf der Exzellenz seines Wissenschaftsstandorts, auf der Zusammenführung grosser europäischer Forschungsinstrumente an einem Ort und auf der sehr starken Synergie zwischen Unternehmen und Forschungsakteuren. Grenoble profitiert von einem reichhaltigen Umfeld im Bereich der Nanotechnologien, mit der Präsenz grosser Industriekonzerne, einer grossen Anzahl von KMU und zahlreichen Forschungslabors.»[5]
Es fällt auf, wenn man im Internet nach Informationen über die NBIC-Konvergenz sucht, dass es nur sehr wenige Präsentierungen von ihren Befürworter·innen gibt. Man findet eher Artikel oder Dokumente über ethische Fragestellungen. Für Hélène Tordjman ist diese Diskretion kein Wunder. Sie haben den Fehler, den Unternehmen wie Monsanto vor einigen Jahrzehnten begangen haben, als der Konzern öffentlich die Vorzüge der Transgenese und ihres Vorzeigeprodukts Roundup pries, sehr gut verstanden. Dies löste einen Aufschrei der Bürger·innen aus, der die Entwicklung dieser Technologien stark bremste.
Die Enthüllungen von Hélène sind verblüffend und erschreckend, aber es ist besser, Bescheid zu wissen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das Team von Inf'OGM gehört zu einem zu kleinen Kreis von Organisationen, die versuchen, diese Entwicklungen zu verfolgen, zu verstehen und anzuprangern. Sie sind deutlich weniger mächtig als die Unternehmen und deren Armee von Lobbyist·innen, die sich für die NBIC-Thematik einsetzen. Inf'OGM verdient unsere Unterstützung. Sie können die Informationen (auf Französisch) abonnieren.
Nicholas Bell
Auszüge aus dem ersten Kapitel des Buches von Hélène Tordjman.
«Konvergenz von NBIC: Auf dem Weg zur totalen Beherrschung der Natur durch die Technologie», greenwashingeconomy.com
«Angesichts des Aufkommens der künstlichen Intelligenz mangelt es uns an Philosophen», Interview mit Laetitia Pouliguen, Le Figaro, 19. Januar 2023.
Auszug aus der Sendung Nr. 18, La convergence NBIC, in der Reihe «Raconte-moi les OGM» von Radio Zinzine.
Auszug von der Website der INP-UGA (Universität Grenoble-Alpes)