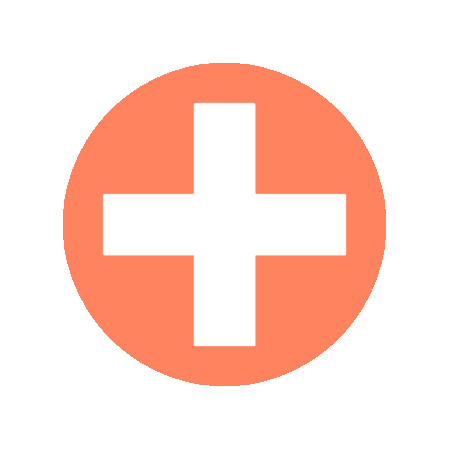Ende Juli wurde die einzige palästinensische Saatgutbank im Westjordanland, eine der stillen Grundlagen des palästinensischen Widerstands, von israelischen Streitkräften angegriffen und zerstört – wieder ein Angriff auf ein lebensnotwendiges Projekt, auf eine Infrastruktur der Nahrungssouveränität in Palästina.
Auf den sich weit erstreckenden Hügeln der Hebron-Berge wurde seit mehr als einem Jahrzehnt ein leises, aber wichtiges Projekt umgesetzt. Die 2010 gegründete «Palestinian Heirloom Seed Bank» (Palästinensische Saatgutbank) war eine einzigartige Initiative, die wissenschaftliche Arbeit, kulturelle Bewahrung und Widerstandskraft der einheimischen Bevölkerung vereinte. Ihre Mission war einfach, aber von grosser Bedeutung: traditionelle Sorten, die seit langer Zeit die palästinensischen Gemeinschaften ernährten und die landwirtschaftliche Identität des Landes prägten, zu sammeln, zu schützen und wieder anzubauen.
Am 31. Juli 2025 wurde diese Kontinuität gewaltsam unterbrochen. Die Anlage für die Saatgutvermehrung wurde von israelischen Streitkräften im Gebiet «C»1 des besetzten Westjordanlands zerstört. Dabei wurden wichtige Teile der Infrastruktur, darunter Bewässerungssysteme, Kontrollgeräte und technische Aufzeichnungen zerstört. Die Anbauflächen, auf denen fünfzehn lokale Sommersorten angebaut wurden, blieben ohne Bewässerung und Überwachungssysteme zurück; die Saatgutproduktion der Saison ist gefährdet. Die Bedeutung dieses Ereignisses liegt in der Struktur, auf die es abzielte. Die Vermehrungseinheit war ein funktionierender Pfeiler der Bank und für die Produktion genau der Sorten verantwortlich, welche die Grundlage einer autonomen, an das Klima angepassten Nahrungsmittelversorgung in Palästina bilden.
Eine in der Erde verwurzelte Vision
Die Saatgutbank wurde als Antwort auf strukturelle Schwachstellen in der palästinensischen Landwirtschaft konzipiert: zunehmende Abhängigkeit von importiertem Saatgut, steigende Kosten für Landwirtinnen und Landwirte und das Verschwinden traditioneller Sorten, da diese für industrielle Modelle ungeeignet sind. Im Laufe der Jahre sammelte und dokumentierte das Team mehr als 80 lokale Pflanzensorten von Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten und Heilpflanzen, bewahrte sie sowohl physisch als auch digital auf und sicherte sie in einigen Fällen international durch Hinterlegung im «Global Seed Vault» in Svalbard. Die Arbeit ging weit über die Konservierung hinaus. Die Bank fungierte als agroökologische Einrichtung, die Landwirt·innen schulte, Felddaten sammelte und die Fähigkeit der Gemeinschaften zur Saatgutauswahl und -konservierung stärkte. Dank ihrer Arbeit konnten jährlich mehr als 500 Landwirt·innen lokal angepasste, widerstandsfähige Pflanzen anbauen, die auch mit Wasserknappheit und klimatischem Stress zurechtkommen. Im Jahr 2025 kam der Vermehrungsanlage eine besondere Bedeutung zu. Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit schwerer Dürre, in denen die Niederschlagsmenge weniger als die Hälfte des Jahresdurchschnitts betrug, kam es in den regenabhängigen Kulturen des Landes zu einem starken Rückgang der Produktivität. Unter diesen Bedingungen war die Verfügbarkeit von lokal angepasstem Saatgut mehr als nur eine Präferenz, sondern eine Notwendigkeit.
Ein Angriff mit strukturellen Auswirkungen
Die gezielte Zerstörung der Vermehrungsanlage war kein isolierter Zwischenfall. In den letzten Jahren war die palästinensische Agrarinfrastruktur wiederholt Bedrohungen ausgesetzt, darunter Gewalt durch Siedler·innen und die Zerstörung von Gewächshäusern und Wasserversorgungsnetzen. In Gaza wurden während der Militäroffensiven von 2023 und 2024 über 85 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche unbrauchbar gemacht. In der gesamten Westbank bestehen weiterhin systematische Beschränkungen des Zugangs zu Land und Wasser. Dieses jüngste Ereignis verschärft die bereits bestehende Fragilität des Agrarsektors. Die Beschädigung der Vermehrungsanlage birgt die Gefahr einer erheblichen Verknappung des Saatguts für die kommende Saison, insbesondere für niederschlagsarme Gebiete, die auf eine präzise Saatgutauswahl angewiesen sind. Ausserdem wird die Vollständigkeit der technischen Überwachung und Saatgutdokumentation gestört, die für jede langfristige ökologische Anpassungsstrategie unerlässlich ist. Der Verlust hat auch kulturelle und historische Dimensionen. Mehrere der betroffenen Saatgutsorten sind einzigartig in Palästina und mit bestimmten geografischen Gebieten und Wissenssystemen verbunden. Ihr Anbau ist Teil einer umfassenderen Praxis, die kulinarische Traditionen, das ökologische Gleichgewicht und die lokale Identität erhält. Die Vermehrungseinheit spielte eine zentrale Rolle dabei, dass diese Sorten nicht nur Artefakte geblieben sind, sondern sich durch die Hände der Landwirt·innen weiterentwickeln konnten.
Im Kern stellt die Saatgutbank eine Infrastruktur der Souveränität dar. Sie fordert einen grundlegenden Aspekt der Autonomie zurück: die Fähigkeit einer Bevölkerung, sein eigenes Ernährungssystem auf der Grundlage ökologischer Logik und kultureller Werte zu wählen, zu kultivieren und zu erhalten. Diese Form der Souveränität ist materiell und relational, sie liegt in den Samen, im Wissen, in den Gewohnheiten des Anbaus und des Austauschs. In dem Kontext langwieriger Besatzung und externer Abhängigkeit gewinnen solche Infrastrukturen eine erhöhte politische Bedeutung. Die Saatgutbank bietet eine Alternative zu Agrarsystemen, die von externen Märkten, Saatgutmonopolen und der Anfälligkeit für Störungen der Lieferkette geprägt sind. Sie ist ein Modell für endogene Entwicklung, das vor Ort verwurzelt ist, auf das Klima reagiert und den Bedürfnissen der Gemeinschaft verpflichtet ist. Die Zerstörung einer ihrer zentralen Einheiten kann daher als struktureller Eingriff verstanden werden, der darauf abzielt, ein selbstorganisiertes Modell der Lebensmittelproduktion zu untergraben. Sie gefährdet sowohl die materiellen Erträge als auch das umfassendere System von Beziehungen und Praktiken, dessen Aufbau Jahre gedauert hat.
Gemeinsame Verantwortung
Die Auswirkungen dieses Ereignisses reichen weit über Palästina hinaus. Der Verlust der landwirtschaftlichen Biodiversität und der Saatguthoheit ist ein globales Problem. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat die Welt im letzten Jahrhundert über 75 Prozent ihrer Pflanzenvielfalt verloren. Initiativen wie die Palästinensische Saatgutbank gehören zu den wenigen, die diesen Trend aktiv umkehren, indem sie verlorene Sorten wiedergewinnen und in die aktuellen Anbausysteme integrieren. Die Rolle der Saatgutbank als wissenschaftliche Ressource, Gemeinschaftseinrichtung und politisches Projekt bleibt ungebrochen. Die Zerstörung, die sie erlitten hat, ist erheblich, aber nicht endgültig. Ihr Fortbestand hängt nicht nur von der Widerstandsfähigkeit ihres Teams und der Bäuerinnen und Bauern ab, denen sie dient, sondern auch von der Solidarität all jener, die die globalen Auswirkungen der Saatgutsouveränität verstehen.
Wir laden Partner·innen, Bewegungen und Einzelpersonen in ganz Europa ein, sinnvolle Massnahmen zu ergreifen. Dazu gehören finanzielle Beiträge zum Wiederaufbau der beschädigten Einrichtung, die Unterstützung von Kampagnen zur Regeneration von Saatgut, die Organisation von Sensibilisierungsveranstaltungen und Bildungsinitiativen oder sogar Besuche in Palästina, um sich ein Bild von der Lage zu machen und direkt mit den Bauerngemeinschaften in Kontakt zu treten. Die Verteidigung der landwirtschaftlichen Autonomie erfordert gemeinsame Verantwortung. In jeder noch so kleinen Solidaritätsbekundung steckt ein Samenkorn der Gerechtigkeit
Fuad Abu Saif, Direktor der UAWC – Union der landwirtschaftlichen Arbeitskomitees
- Teil des Westjordanlandes unter israelischer Kontrolle und Sicherheitsverwaltung