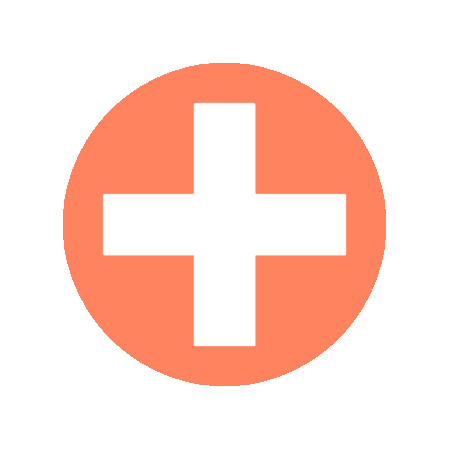Der konstruktive Austausch zwischen Menschen und Gruppen über die Grenzen der Meinungsblasen hinaus wird immer rarer. Immer mehr Menschen nutzen die grossen digitalen Plattformen als erste Informationsquellen, um mit anderen in Kontakt zu bleiben oder um eigene Inhalte zu verbreiten. Was sich als «Soziale Medien» verkauft, sind das jedoch kommerzielle Plattformen, die weder sozial ausgerichtet sind noch die Verantwortung für die von ihnen verbreiteten Inhalte wahrnehmen.
Digitale Plattformen leben vom Geschäft der Aufregung und der Zuspitzung. Konfrontation, Hass und Desinformation werden mit Klicks belohnt. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit unterstützen sie mit ihren Geschäftsmodellen die Verbreitung von hetzerischen und spaltenden Inhalten. Immer öfter schrillen die Alarmglocken, weil diese Form der Kommunikation die Demokratie bedroht und vor allem rechtsextremen Gruppen und Parteien wie der AfD in Deutschland oder der FPÖ in Österreich in die Hände spielt. Zusätzlich steigen viele ehemals seriös arbeitende Medien in die Logik der Aufregungsökonomie ein und wetteifern mit den Plattformen oder gehen vielmehr mit ihnen eine Symbiose ein.
Was muss sich ändern, damit Medien die Demokratie bestmöglich unterstützen? Mit dieser Frage haben sich die «Bürger·innenräte Medien und Demokratie» im Frühjahr 2025 in Irland, Österreich, Slowenien und Tschechien auseinandergesetzt, ihre Vorstellungen und Ansprüche diskutiert und eine Reihe von Resolutionen erarbeitet und beschlossen. In jedem Land umfasste der Bürger·innenrat eine Gruppe von zwanzig Menschen im Alter von 18 bis 80+ Jahren mit den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Hintergründen und Biografien. Die Bürger·innenräte traten im Zeitraum von März bis Mai 2025 an vier Samstagen zusammen und berieten sich jeweils zu einem anderen Schwerpunkt. Am ersten Tag stand das Zusammenspiel von Medien und Demokratie im Mittelpunkt. Danach ging es um Einblicke in Mediensysteme und die Medienregulierung, im weiteren um Partizipation in und durch Medien sowie zuletzt um gesellschaftliche Repräsentation in den Medien. Das Aushandeln der Spielregeln für ihre Arbeitsweise und die Form sowie die Regeln der Beschlussfassungen lagen bei den Bürger·innen selbst. Unterstützt wurden sie jeweils von einem professionellen Moderations- und Organisationsteam.
Was ist für mich Demokratie?
Die Beratungen starteten in allen Ländern mit der Frage: «Was ist für mich Demokratie und welche Ansprüche an Medien habe ich, um meine Vorstellung von Demokratie leben zu können?». Im Gegensatz zu unserer umfassenden Nutzung und Mitgestaltung von Medien sind die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Verflechtungen mit der Politik – in Österreich unter dem Schlagwort «Inseratenkorruption» – ein komplexes Feld, auch für Jurist·innen und Politiker·innen. Um hier tiefergehende Einblicke zu gewinnen, standen den Bürger·innenräten an jedem Termin eine Reihe von Expert·innen aus der Wissenschaft und aus der Medienpraxis als Auskunftspersonen zur Verfügung. Die beteiligten Bürger·innen gewannen so tiefgehende Einblicke in Strukturen und Zusammenhänge, auf die sie dann in den Überlegungen zu ihren Ansprüchen an Medien und an die Demokratie aufbauen konnten. Im Ablauf der Beratungstage stand am Anfang jeweils die «Lernphase» mit Expert·innen, gefolgt von abwechselnden Phasen der Beratung in Kleingruppen zur Formulierung von Vorschlägen, Berichten, dann Diskussionen im Plenum und am Ende des Tages die Beschlussphase.
Die Beratungen aller Bürger·innenräte waren geprägt vom Respektieren anderer Meinungen und Bedürfnisse, sowie der Neugier, andere Perspektiven zu verstehen, und gemeinsame Antworten zu formulieren und abzustimmen. Thematisch fokussierten die Anliegen auf die Förderung von Medienqualität, die Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und der gesellschaftlichen Repräsentation in den Medien. Ein verbindendes Thema in allen Ländern war auch die Forderung nach mehr Medienbildung für alle Generationen. In den Diskussionen kam die Sprache immer wieder auf die Dringlichkeit der «Ent-Bubbelung», dem Aufbrechen der «Blasen», in denen sich immer mehr Menschen bewegen und so nicht mehr bereit sind, sich mit anderen Positionen oder Meinungen konstruktiv auseinanderzusetzen. Der Bürger·innenrat selbst war ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht nur möglich ist, sondern auch spannend und motivierend sein kann.
Alle Bürger·innenräte formulierten und beschlossen jeweils eine Liste von 20 bis 50 Anregungen und Forderungen, die sich an die Politiker·innen, an die Medien, an Bildungsverantwortliche, aber auch an die Gesellschaft richten. Ebenso wichtig für die Beteiligten waren aber die persönlichen Erfahrungen und das Erleben, dass es möglich und spannend ist, sich über Meinungsgräben hinweg konstruktiv auszutauschen und gemeinsam Ergebnisse zu erarbeiten. Viele bestätigten beim letzten Treffen, dass es motivierend war, gemeinsam am Thema zu arbeiten und neue Formen des Engagements auszuprobieren. Die Etappen der Bürger·innenräte wurden jeweils in kurzen Blogbeiträgen1 festgehalten und können so auch nachverfolgt werden.
Die Anregungen und Forderungen
In Irland forderten die Bürger·innen unter anderem die Basisfinanzierung für nicht-kommerzielle Community Medien, die Verankerung eines verpflichtenden Mindestlohns für Journalist·innen, die Behandlung der Digitalen Plattformen als Medien sowie die vierteljährliche Abhaltung von Medienforen, bei denen Medienverantwortliche und Medienpolitiker·innen über ihre Tätigkeiten berichten und interessierten Bürger·innen Rede und Antwort stehen müssen.
In Slowenien stand die Forderung nach mehr Transparenz zu den Besitzstrukturen von Medien sowie die Stärkung nichtkommerzieller Medien im Vordergrund. Weiters wurde verlangt, dass benachteiligte soziale Gruppen, über die berichtet wird, stets auch selbst zu Wort kommen müssen. Ausserdem wurden Programme gefordert, die nicht nur die Vermittlung von kritischer Medienkompetenz fördern, sondern explizit auch Vertreter·innen benachteiligter Gruppen leichteren Zugang zum Journalismus und zu den Medien verschaffen.
In Tschechien wurden Massnahmen gegen die Medienkonzentration, die Unterstützung von kritischen Journalist·innen gegen SLAPP-Klagen[2] und der Journalist·innengewerkschaft generell sowie die Inflationsanpassung der Rundfunkgebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert. Eine ganze Reihe von Forderungen unterstützen die Arbeit von lokalen Community Medien und die Einbindung von Minderheitenvertreter·innen in Medienregulierung und Journalismus. In Österreich zog sich der Anspruch, Medien nach expliziten Qualitätskriterien zu fördern und Entscheidungsprozesse auch transparent zu machen, durch alle Beratungstage. Da der Zugang zu seriösen Medieninhalten mit Kosten verbunden ist, sollen sozial benachteiligte Personen auch kostenfreien Zugang erhalten und an öffentlichen Orten, an denen derzeit vor allem Gratiszeitungen präsent sind, vermehrt Qualitätsmedien zugänglich gemacht werden. Die Europäische Kommission wird aufgefordert, für demokratiefördernde Algorithmen bei den Digitalen Plattformen einzutreten. Eine Besonderheit in Österreich war, dass die Exper·innen-Inputs auch per «Graphic Reporting» dokumentiert wurden. In allen beteiligten Ländern fanden Veranstaltungen statt, um die Resolutionen der Vertreter·innen aus Medien, Politik und der Zivilgesellschaft vorzustellen und mögliche Schritte zur Umsetzung zu diskutieren. Die Beteiligten waren sich einig, dass die Bürger·innenräte weiterarbeiten sollten und es dringend wäre, zu vielen anderen gesellschaftlichen Themen solche Räte einzurichten.
Die «Bürger·innenräte Medien und Demokratie» sind Teil des Forschungsprojekts «Mapping Media for Future Democracies (MeDeMAP)»[3], das sich mit der Frage beschäftigt, was Medien leisten müssen, um die Demokratie bestmöglich zu unterstützen. Für die Konzeption und Koordination der Bürger·innenräte war der Verein COMMIT verantwortlich, der dabei auch vom Europäischen Bürger:innen Forum unterstützt wurde. Die Partner·innen waren das Friedensinstitut in Slowenien und universitäre Einrichtungen in Irland und Tschechien. Das Gesamtprojekt MeDeMAP wird von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften koordiniert. Am 24.9. gibt es im Rahmen des letzten Projekttreffens einen runden Tisch, bei dem Vertreter·innen aus den vier Ländern die Ergebnisse im Kontext kurz vorstellen. Die Teilnahme daran ist online möglich und vielleicht hat jemand Lust hineinzuhören. Den Link dazu findet ihr auf unserer homepage.
Helmut Peissl, EBF-Österreich und Geschäftsführer von COMMIT
www.medemap.commit.at/medemap-blog
SLAPP: Strategic lawsuit against public participation (Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung)
www.medemap.eu