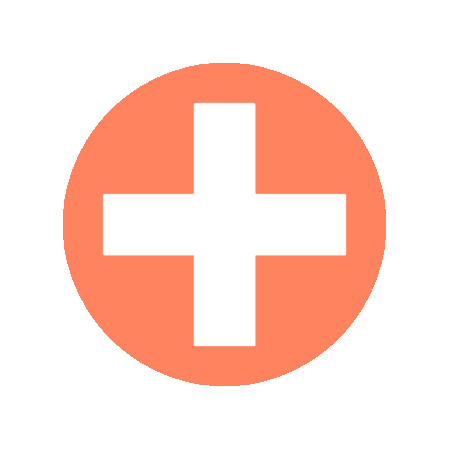In der Schweiz und weiteren westeuropäischen Ländern wurde in den vergangenen Monaten über grosse Romafamilien aus der westukrainischen Provinz Transkarpatien berichtet. Diese werden als unerwünschte Nutzniesserinnen des Schutzstatus für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge stigmatisiert, auch wenn das von den Behörden und in den meisten Medien – wohl aus Angst vor Rassismusvorwürfen – nicht ganz so grob formuliert wird.
Das Schweizer Parlament will nun den Schutzstatus nur mehr denjenigen Ukrainer·innen erteilen, die aus etwas willkürlich bestimmten Kriegsgebieten aus dem Osten und Süden der Ukraine geflüchtet sind, zu denen Transkarpatien also nicht gehört. Die transkarpatischen Roma hätten also keinen Anspruch mehr auf Aufenthalt und Schutz in der Schweiz und müssten ausreisen.
Das Europäischen Bürger:innenforum (EBF) ist seit über drei Jahrzehnten in Transkarpatien tätig und kennt die dortige Situation und die Lebensbedingungen der Roma.
Besuch im Tabor[1]
Die grösste Romasiedlung der Ukraine befindet sich in der Provinzstadt Mukatschewo in Transkarpatien. Vor dem Krieg lebten hier etwa 15’000 Roma, mehr als die Hälfte von ihnen in absoluter Armut. Wenn man die Hauptstrasse dieses hinter dem Bahnhof gelegenen Ghettos verlässt, stösst man auf enge, schmutzige Gassen mit schäbigen Hütten ohne Wasser und Kanalisation, Strom wird irgendwo abgezapft. Überall liegen Berge von Müll. Magere Frauen in Sandalen und – trotz allem – fröhliche Kinder fragen unsere ortsvertraute Begleiterin, welche Fremde sich hier hinein wagen.
Nun hat der Krieg dieser düsteren, abgeschiedenen Welt eine Überraschung beschert. Im Sommer 2022 flüchtete eine Gruppe von etwa 60 Roma aus der Stadt Wuhledar im Donbas und erreichte schliesslich Mukatschewo. Wuhledar wurde nach mehr als zweijährigen, für beide Seiten äusserst verlustreichen Kämpfen am 1. Oktober 2024 vollständig von der russischen Armee erobert. Heute ist sie eine Geisterstadt, die nur aus Ruinen besteht. Die Roma von Wuhledar waren in ihrer Heimat gut integriert, sie sind gebildet und vergleichsweise wohlhabend. Manche führten eigene kleine Unternehmen. Rada Kalandiia ist mit ihrem Mann Edvard, einem aus Abchasien geflüchteten Georgier, ihrer 15jährigen Tochter und weiteren Familienmitgliedern gemeinsam mit dieser Gruppe aus Wuhledar nach Mukatschewo geflüchtet. Der Vater von Rada hat sich sein ganzes Leben für die Rechte der Roma im Donbas eingesetzt und Rada führt dieses Engagement fort. Bei ihrer Ankunft in Transkarpatien war sie von den Lebensumständen der hiesigen Roma schockiert. «Für mich war es unvorstellbar, dass Roma im 21. Jahrhundert so leben. Es könnte das 15. Jahrhundert sein!»
Chirikli
Mit Unterstützung der ukrainischen Roma-frauenorganisation Chirikli, der sie angehört, sowie einer tschechischen Organisation, konnte sie mit einigen einheimischen Mitstreiter·innen ein grösseres Gebäude anmieten[2]. Rada verfolgt eine klare Strategie, um die Bewohner·innen dieses Slums Schritt um Schritt aus dem Teufelskreis der Misere zu befreien. Die meisten dieser Roma sind Analphabet·innen. Rada hat keine Hoffnung, die Erwachsenen zu beeinflussen, sie zählt auf Bildung und Erziehung der Kinder. Die meisten von ihnen haben nie eine Schule besucht, und kennen auch elementare Grundregeln der Hygiene nicht. Radas Mitarbeiterin, die Juristin Tetiana ist nicht Roma, sondern stammt aus der ungarisch-jüdischen Bevölkerung von Mukatschewo. Sie erzählt von zehnjährigen Kindern, die erschrecken und sich vor dem Wasser verstecken, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben unter einer Dusche stehen. Im Zentrum «Romodrom» am Rande des Ghettos lernen die Kinder aber auch, dass es nützlich ist, die Uhrzeit und den Wochentag zu kennen. Ein weiteres Problem ist, dass diese Roma ihre ursprüngliche Sprache «vergessen» haben. Viele von ihnen sprechen ausschliesslich ungarisch, was bei Behördengängen, bei einem Arzttermin und eventuell bei der Arbeitssuche natürlich auch ein Problem ist.
Um sich auf den Herausforderungen der Misere des Mukatschewer Romaghettos zu stellen, braucht es viel Mut und unerschütterliche Zuversicht, und vielleicht noch wichtiger, eine grosse Zuneigung zu diesen Menschen. All dies spürt man beim gemeinsamen Besuch sehr deutlich, aber auch die nötige Portion Realismus.
Tuberkulose und Hunger sind weitverbreitet. Ebenso Wucher, den reichere Roma gegenüber den Ärmsten schamlos ausüben. Mikrokredite von 1000 Hryvna müssen nach einem Monat mit 1’800 Hryvna beglichen werden. Als Pfand hinterlassen sie ihren Pass oder die Geburtsurkunde, ohne die die kinderreichen Familien ihre Sozialhilfe vom Staat nicht empfangen können.
Um die Eltern zu motivieren, ihre Kinder in die Nachmittagsschule zu schicken, damit sie lesen, schreiben und rechnen lernen, verteilt Chirikli nach Möglichkeit humanitäre Hilfe, Lebensmittel und Hygieneartikel. So haben sie das Vertrauen der Familien gewonnen und wir haben Jungen und Mädchen gesehen, die ganz offensichtlich Spass daran hatten, ihre Aufgaben in ihre Hefte zu schreiben. Eine Lehrerin aus der nahegelegenen öffentlichen Schule kommt dafür jeden Tag in das Zentrum. Gaspar, ein Freiwilliger und vergleichsweise wohlhabender Roma kocht für diese Kinder in der Schulkantine, für viele Kinder ist dies die einzige Mahlzeit, die sie am Tag bekommen. Ausserdem kocht er mindestens einmal im Monat auf offenem Feuer in der Strasse einen riesigen Kessel Bograsch, der hiesigen Variante von Gulasch und versorgt damit bis zu 1000 Personen.
Das Team von Chirikli hilft den Roma von Mukatschewo auch im Kampf gegen die Diskriminierung. Ohne Unterstützung einer gebildeten Person ist es für diese sehr schwierig, zum Beispiel einen Pass, eine Heirats- oder Geburtsurkunde zu bekommen; häufig werden unrechtmässig Schmiergelder gefordert. Ebenso ist der Zugang zu den städtischen Gesundheitsdiensten sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite haben die Roma meist keine Ahnung von ihren Rechten als Bürgerinnen und Bürger der Ukraine.
Andere Probleme der Roma sind hausgemacht. Aus Tradition heiraten die Mädchen bereits, wenn sie kaum in der Pubertät sind und bekommen ihre ersten Kinder als Teenagerinnen. Verhütungsmittel sind auch unter den Erwachsenen kaum verbreitet und werden von vielen Männern immer noch abgelehnt. Rada Kalandiia hat bereits mehrere Dutzend Frauen, die sich diesbezüglich helfen lassen wollen eine konkrete Unterstützung zukommen lassen – nicht immer im Wissen ihrer Männer.
Die Aussichten
Wir teilen die Überzeugung von Rada Kalandiia, dass Hilfe für die Roma von Transkarpatien nicht von aussenstehenden Organisationen verwaltet und verteilt werden sollte. Das Europäische Bürger:innenforum hat Chirikli bereits spontan für die Einrichtung eines kleinen Frauenzentrums unterstützt und möchte diese Hilfe nach Möglichkeiten in Zukunft ausbauen. Ausser materieller Unterstützung ist aber auch massiver Druck auf die staatlichen Behörden nötig, um die Diskriminierung der Roma zu durchbrechen.
Jürgen Kräftner, EBF Transkarpatien
Tabor heisst eigentlich einfach «Lager», in der Ukraine ist damit aber klar eine Romasiedlung gemeint.
Diese Miete steht allerdings auf wackligen Füssen, da sich die tschechische Organisation nicht langfristig engagieren möchte.